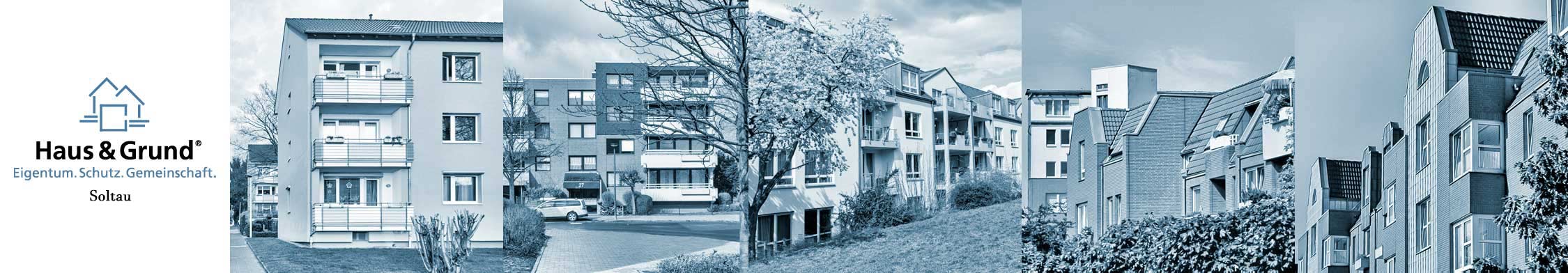
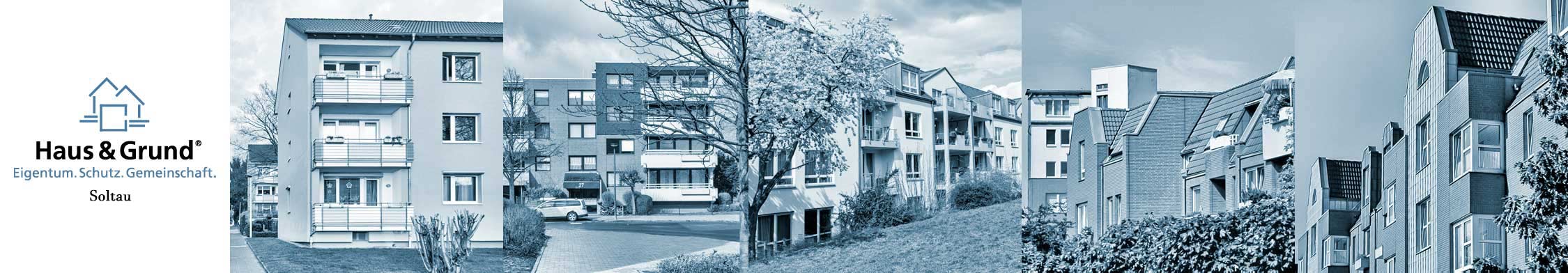 |
| |
| Home > News/Presse > Schönheitsreparaturen: Einzelabrede |
Schönheitsreparaturen: Einzelabrede als Ausweg?
Wie aber ist zu entscheiden, wenn es sich nicht um vorgedruckte und dem Mieter als Vertragspartner „gestellte“ Formularklauseln handelt, sondern um ausgehandelte Einzelabreden? Diese Frage hatte der BGH in den folgenden Fall zu klären: Der Mietvertrag endet. Mieter M verlangt die Rückzahlung der geleisteten Kaution. Vermieter V rechnet mit Gegenforderungen auf, unter anderem mit einem Zahlungsanspruch aus einer Quotenabgeltungsvereinbarung. Diese Vereinbarung war zunächst Inhalt eines Vertrags mit den Vormietern. M hatte bei Beginn des Mietverhältnisses diesen Vertrag einschließlich der Quotenregelung übernommen. Nach dem Wortlaut der „Vereinbarung“ zwischen V und M war dies zuvor ausdrücklich verhandelt worden. Dazu trägt V vor, als Alternative sei die Zahlung einer um 80 € erhöhten Miete ohne Abwälzung der Schönheitsreparaturlast und ohne Quotenabgeltung angeboten worden. Die Berufungsinstanz spricht die Rückzahlungsklage der erbrachten Kautionsleistung in vollem Umfang zu; die Quotenvereinbarung sei unwirksam, eine darauf gegründete Aufrechnung mit einer nicht entstandenen Forderung könne deshalb den eingeklagten Rückzahlungsanspruch nicht schmälern. Der BGH beurteilt im Ergebnis anders und verweist zur
weiteren Sachaufklärung zurück. Richtig sei, dass eine als Formularklausel
vereinbarte Quotenabgeltungsregelung für angelaufene Renovierungsintervalle
bei Vertragsende unwirksam sei (st. Rspr.: BGH, Urteil vom 18.3.2015 -
VIII ZR 242/13, BeckRS 2015, 8111 = FD-MietR 2015, 368139). Diese Bestimmung aber sei abdingbar. Sie könne deshalb sowohl in Form einer Formularklausel (begrenzt) als auch individualvertraglich wirksam zwischen den Mietvertragsparteien abgeändert werden (hinweisend auch: Deutscher Bundestag, Drucksache 14/4553, Seite 40; Staudinger/V. Emmerich, Kommentar zum BGB, Neubearbeitung 2021, § 535 BGB Rn. 109; Häublein, in:. Münchener Kommentar zum BGB, 9. Aufl., § 535 BGB Rn. 146; Siegmund, in: Beck OK-Mietrecht - Stand 1.11.2023, § 535 BGB Rn. 5246). Wolle man eine im Einzelnen ausgehandelte Einzelabrede annehmen, so müsse
der Vermieter als Verwender dieser Vereinbarung die betreffende Klausel
inhaltlich ernsthaft zur Disposition stellen und sich deutlich und ernsthaft
zur gewünschten Änderung der Klausel bereit erklärt haben.
Allein die (hier erfolgte) Vorstellung von Wahlmöglichkeiten zwischen
mehreren vorformulierten Vertragsbedingungen mache die dann vom Vertragspartner
gewählte Alternative noch nicht zu einer „ausgehandelten“
Individualabrede (ebenso schon: BGH, Urteil vom 17.2.2010 - VIII ZR 67/09,
BGHZ Bd. 184, 259). Dieser Schluss käme nur in Betracht, wenn der
Mieter selbst Gelegenheit gehabt hätte, alternativ eigene Textvorschläge
mit der effektiven Möglichkeit ihrer Durchsetzung einzubringen (ebenso
bereits: BGH, Beschluss vom 20.11.2012 - VIII ZR 137/12, WuM 2013, 293
Rn. 7; BGH, Urteil vom 20.1.2016 - VIII ZR 26/15, NJW 2016, 1230 Rn. 25;
BGH, Urteil vom 13.3.2018 - XI ZR 291/16, NJW-RR 2018, 814; BGH, Beschluss
vom 19.3.2019 - XI ZR 9/18, NJW 2019, 2080). Nachzutragen bleibt: Abgesehen davon, dass dafür das Angebot mehrerer Regelungsmöglichkeiten nicht ausreicht (BGH, Urteil vom 17.2.2010 - VIII ZR 67/09, BGHZ Bd. 184, 259), galt schon früher eine Vertragsbedingung bereits dann für eine Vielzahl von Verträgen als vorformuliert - und damit als Formularklausel im Sinne des AGB-Klauselkontrollrechts, wenn ihre 3-malige Verwendung beabsichtigt war (BGH, Urteil vom 27.9.2001 - VII ZR 388/00, NJW 2002, 138). Die Rechtsprechung zur Annahme des Tatbestandsmerkmals „Vielzahl“ in § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB hat sich mittlerweile stark verschärft. Schon die erstmalige Verwendung der AGB durch den Verwender soll genügen (BGH, Urteil vom 17. Februar 2010 - VIII ZR 67/09, NJW 2010, 1131, 1132). Dann aber kommt es auf die Absicht einer Mehrfachverwendung nicht mehr an (ausdrücklich: BGH, Beschluss vom 23.8.2016 – VIII ZR 23/16, WuM 2016, 656 = ZMR 2016, 851 = NZM 2017, 71 = NJW-Spezial 2017, 2 = NJW-RR 2017, 137 Rn. 11 der Entscheidungsgründe nach juris; Graf von Westphalen, NJW 2017, 2237, 2237 mit weiteren Nachweisen zur Rechtsprechung). Im Falle eines Verbrauchervertrags ist die Regelung bereits gesetzlich strenger; hier genügt die einmalige Verwendungsabsicht (§ 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB). Von einem Verbrauchergeschäft ist bereits immer dann auszugehen, wenn der Vermieter als Unternehmer einzustufen ist und an eine Privatperson (Verbraucher) vermietet. Von der Verbrauchereigenschaft eines Wohnraummieters ist immer auszugehen; dies auch dann, wenn er freiberuflich oder gewerblich tätig ist. Denn nach einmütiger Auffassung hat seine berufliche Orientierung mit seinen privaten Dispositionen nichts zu tun. © Dr. Hans Reinold Horst |