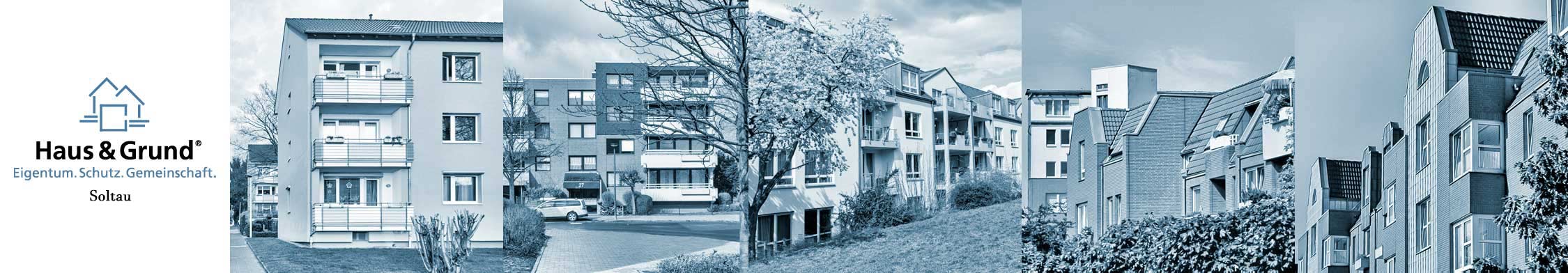
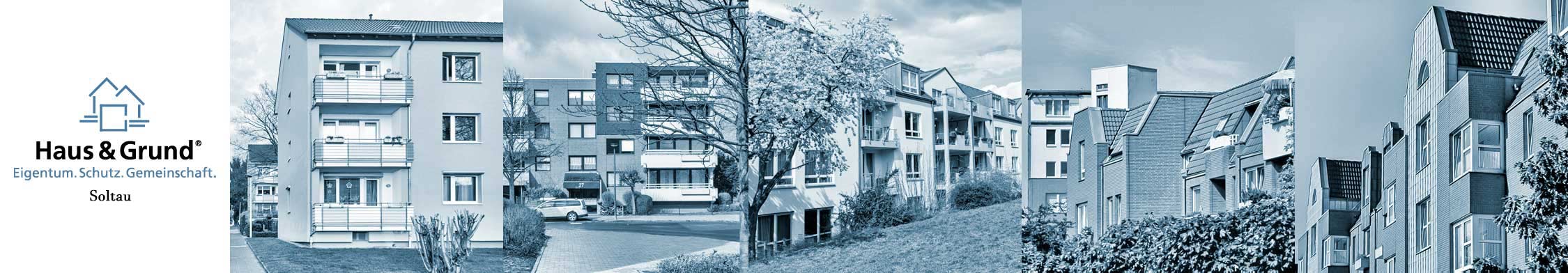 |
| |
| Home > News/Presse > Wohin mit der neuen Zentralheizung? |
Wohnungseigentum und Heizungstausch: Wohin mit der neuen Zentralheizung?
Unter den Wohnungseigentümern selbst konnte eine denkbare Lösung in §§ 10 Abs. 2, 14 Abs. 1 und Abs. 3 WEG liegen; danach ist jeder Wohnungseigentümer gegenüber der Gemeinschaft verpflichtet, das Betreten seines Sondereigentums und andere Einwirkungen auf dieses und das gemeinschaftliche Eigentum zu dulden, die den Vereinbarungen oder Beschlüssen entsprechen, oder, wenn keine entsprechenden Vereinbarungen oder Beschlüsse bestehen, aus denen ihm über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus kein Nachteil erwächst. Dafür ist der mit entsprechender Duldungspflicht (aus § 18 Abs. 1 Nr. 2 WEG in Verbindung mit § 242 BGB und dem Treueverhältnis der Wohnungseigentümer untereinander abgeleitet) „zwangsenteignete“ betroffene Sondereigentümer in Geld zu entschädigen. Eine entsprechende Änderung des Nutzungszwecks durch Vereinbarung könnte auf der Anspruchsgrundlage von § 10 Abs. 2 WEG in Verbindung mit § 242 BGB und dem Treueverhältnis der Wohnungseigentümer untereinander erfolgen. Diesen Anspruch kann aber nicht die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer einklagen, sondern nur die einzelnen Eigentümer selbst. Das LG Frankfurt/Main trifft jetzt eine Entscheidung in einem ähnlich gelagerten Fall, die weiterhelfen kann (LG Frankfurt/Main, Urteil vom 13.3.2025 - 2-13 S 8/24, BeckRS 2025, 4858). Dort befindet sich die allgemein versorgende Zentralheizung in einem Keller, der im Sondereigentum nur eines Eigentümers steht. Der Eigentümer möchte sein Sondereigentum uneingeschränkt nutzen und will, dass die Heizung dort entfernt wird. Das Gericht urteilt, der Eigentümer sei jedenfalls aufgrund seiner Treue- und Rücksichtnahmepflichten so lange verpflichtet, die Heizungsanlage in seinem eigenen Keller zu dulden, bis die Gemeinschaft eine alternative Heizmöglichkeit geschaffen habe. Auf die Frage der Sondereigentumsfähigkeit des Raumes komme es dabei nicht an. Der Fall unterscheidet sich dadurch, dass bei einer wohnungsbezogenen Einzelversorgung noch keine Heizung in einem Keller steht. Der Rechtsgedanke der Treue- und Rücksichtnahmepflichten innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft zieht aber gleichwohl. Denn der Gemeinschaft ist es gesetzlich aufgegeben, einen Heizungsumtausch möglichst mit einer zentralen Versorgungslösung zu vollziehen (§ 71 n GEG). Sie kommt also mit einer entsprechenden baulichen Veränderung einer gesetzlich aufgegebenen Verpflichtung nach. Natürlich hat sie alternative Unterbringungsmöglichkeiten zu prüfen und - falls möglich - zu schaffen. Kann die Heizung wie in aller Regel nur im Gebäude selbst untergebracht werden, so kommt nur ein Umbau der Kelleretage mit Grundrissveränderung in Betracht. Auch ein solcher Umbau mit Grundrissveränderung im Kellergeschoss dürfte für heftige Diskussionen sorgen, wenn damit eine Verkleinerung der „eigenen“ Fläche bei Keller- oder Abstellräumen einhergeht. Für den Vermietungsfall ist diese Frage nicht befriedigend zu lösen; denn dem betroffenen Mieter stehen Mietminderungen und Ansprüche auf Wiedereinräumung des vertragsgemäßen Gebrauchs zur Seite (vgl. BGH, Hinweisbeschluss vom 12.10.2021 - VIII ZR 51/20, juris). Das gilt sowohl bei Entzug eines Kellerraums als auch im Falle einer Verkleinerung durch Grundrissveränderung. Die Praxis wird dieses Problem dadurch auszublenden versuchen, dass man mit Wärmepumpen in den Außenbereich ausweicht oder weiterhin räumlich kleinteiligere etagenbezogene Lösungen zur Wärmeversorgung anstrebt. Lesetipp zum Heizungsumbau nach dem Gebäudeenergiegesetz:
© Dr. Hans Reinold Horst |