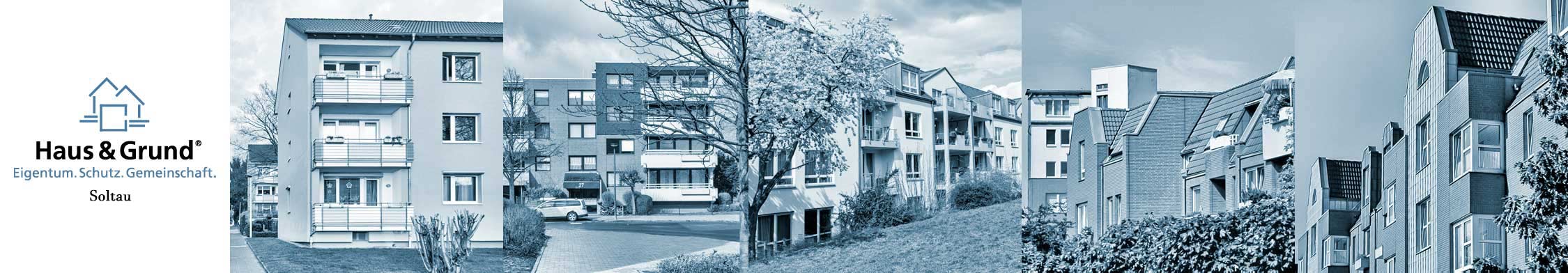
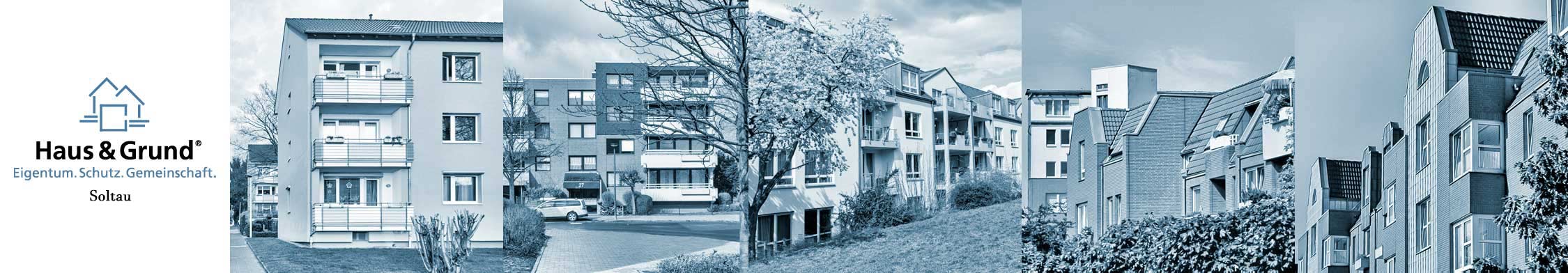 |
| |
| Home > News/Presse > Perspektive zur Wohnungswirtschaft |
Bundestagswahl: Perspektive zur Wohnungswirtschaft und zum immobilienbezogenen Recht
KoalitionsansätzeDie Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaften zum Koalitionsvertrag zu den wichtigsten Themen - Wohnen, Mieten, Bauen und Energie - für private Eigentümer:
Geplant war außerdem, die Haltefrist von 10 Jahren seit Anschaffung einer Immobilie aus der „Spekulationssteuer“ herauszunehmen, Veräußerungsgewinne also immer zu besteuern (§ 23 EStG). Auf vielfachen Druck sind diese Pläne einstweilen fallen gelassen worden, weil häufig Vermögensplanungen im Rahmen der Altersvorsorge und der Altersversorgung betroffen wären. Kurz: Die Haltefrist soll also nicht angefasst werden. Erste BewertungEine erste Bewertung ernüchtert. Fast ist man versucht den berühmten Romantitel von Erich Maria Remarqué „Im Westen nichts Neues“ zu zitieren. Denn unser dringendstes Problem - die angemessene Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum - wird weder angefasst, noch gelöst. Denn mit Mietpreisbremsen für die Eingangsmiete, Reibereien um Kappungsgrenzen bei der Mieterhöhung, und mit Umwandlungsverboten für die Bildung von Wohnungseigentum kommt man nicht weiter. Vor allem Dingen ist die Mietpreisbremse gescheitert. Sie gehört abgeschafft. Steigende Mieten sind die Folge eines zu geringen Angebots. Neue Wohnungen baut man mit Kapital, nicht mit ständig beschnittenen Finanzressourcen. Eine weiter abgesenkte Kappungsgrenze beschneidet die Möglichkeit für angemessene und moderate Mieterhöhungen so stark, dass der Neubau von bezahlbarem Wohnraum für die Mitte der Gesellschaft zum Erliegen kommen wird. Denn jeder Investor muss rechnen. Weiter beschnittene Mieterhöhungsmöglichkeiten zur Refinanzierung des investierten Kapitals, zur Instandhaltung, zur Modernisierung insbesondere in Klimaschutzfragen machen eine Vermietung unattraktiv. Wer den Wohnungsbau ernsthaft wieder ankurbeln will, darf die Einnahmenseite der Investoren und Risikoträger nicht weiter ausdünnen. Insgesamt zeigt die Erfahrung: Steigende Kosten und mehr Klimaschutz im Gebäudebereich bei gleichzeitiger
Begrenzung der Mieteinnahmen: haben bisher nicht funktioniert und werden
das auch in Zukunft nicht tun. Das traurige Ergebnis kennen alle aus der
bisherigen Politik: Die Zahl der genehmigten Wohnungen ist seit Januar
2022 bis heute kontinuierlich gesunken. Von Januar 2022 bis Ende 2024
war ein Rückgang von rd. 48 % der Baugenehmigungszahlen festzustellen. Wichtig wäre vor allem, die Grunderwerbsteuer zu senken und damit
den Einstieg ins eigene Immobilieneigentum zu erleichtern. Aktuelle GesetzesvorhabenAktuell werden zwei Gesetzesentwürfe im Bundesrat weiter behandelt, die noch von der alten Bundesregierung stammen. Sie unterfallen deshalb nicht der Diskontinuität, müssen also nach dem Scheitern der Ampel-Regierung nicht neu aufgesetzt werden, sondern werden weiter behandelt. Sie werden jetzt dem Parlament zugeführt. Was letztlich hinten rauskommt, ist abhängig von dem dann aktuellen politischen Mainstream. Aus diesen beiden Ansätzen lassen sich in der Sache folgende Punkte zusammentragen: Verlängerung und Erweiterung der Mietpreisbremse Die Mietpreisbremse soll ein weiteres Mal bis zum 31.12.2029 verlängert
werden (Kabinettsbeschluss v. 11.12.2024 – Regierungsentwurf, Deutscher
Bundestag, Drucksache 20/14672 vom 27.1.2025, bereits im Bundesrat beschlossen
am 14.2.2025, Bundesrat-Drucksache 606/24 (Beschluss) vom 14.2.2025).
Das Sondierungspapier der sich abzeichnenden neuen Bundesregierung (SPD/CDU/CSU)
- Stand 8. März 2025 - führt aus, dass die Mietpreisbremse nur
für zwei Jahre bis Ende 2027 verlängert werden soll, trifft
jedoch für die weiteren genannten Punkte keine Aussagen. Hintergrund: Die „Mietpreisbremse“ (§§ 556 d BGB ff.), bezieht
sich innerhalb angespannter Wohnungsmärkte (höhere Nachfrage
im Vergleich zum Angebot von Mietwohnraum bei entsprechender Mietenentwicklung
nach oben) auf die Eingangsmiete. Das ist die Zahl, die im Mietvertrag
steht und ab dem Beginn des Mietverhältnisses als Nettomiete gilt.
Sie darf in den genannten Gebieten nur 10 % (statt 20 % im Normalfall)
über der ortsüblichen Vergleichsmiete verhandelt werden. Soweit
kurz skizziert der Inhalt der Regelung im Bundesmietrecht. Welche Gemeinden
oder Gemeindeteile als Gebiete mit angespannter Wohnraumversorgung gelten,
legt das jeweilige Bundesland fest. Von der Mietpreisbremse gibt es folgende Ausnahmen:
Der Kreis der Neubauten, die unter die Preisbremse fallen, soll auf Neubauten erweitert werden, die bis zum 01.10.2019 errichtet wurde (§ 556 f S. 1 BGB-Entwurf). Alle weiteren Vereinbarungen und Prüfaufträge aus dem Koalitionsvertrag der zerbrochenen „Bundes-Ampel“ werden im Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung der Wohnraummiete zusammengefasst. Dieser Gesetzesentwurf ist in den Bundesrat eingebracht worden (Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Bundesrat-Drucksache 5/25 vom 3.1.2025), der das Paket ebenfalls am 14.02.2025 beschlossen hat (Bundesrat-Drucksache 5/25 - Beschluss - vom 14.02.2025). Weitere Absenkung der (abgesenkten) Kappungsgrenze Bei Mieterhöhungen im Vergleichsmietensystem soll die bereits von 20 % auf 15 % abgesenkte Kappungsgrenze für Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten künftig nochmals auf 11 % reduziert werden (§ 558 Abs. 3 BGB-Entwurf). Hintergrund: Soll die Miete innerhalb der Vertragszeit erhöht werden, so muss
bei Mieterhöhungen im Vergleichsmietensystem zweimal gerechnet werden;
einmal der Mietwert, den man mit einem Begründungsmittel (zum Beispiel
Mietspiegel) abgeleitet aus der dort ausgewiesenen ortsüblichen Vergleichsmiete
auf die Einzelvertragsmiete der konkreten Wohnung errechnet, und zum anderen
den 120-prozentigen Mietwert, bezogen auf die vor 3 Jahren geschuldete
Miete. Der jeweils kleinere Wert gilt und begrenzt die Möglichkeit
eines Erhöhungsverlangens. Liegt die mit 120 % angesetzte und vor
3 Jahren geschuldete Miete unterhalb des Mietspiegelwerts, wird der Mietspiegelwert
also „gekappt“. Deswegen nennt man diesen 20-prozentigen Anteil
„Kappungsgrenze“. Verlängerung des Betrachtungszeitraums im Mietspiegel Schon zur Jahreswende 2019/2020 ist der Betrachtungszeitraum für Mietwerte, die innerhalb eines zu erarbeitenden Mietspiegels angesetzt werden, von 4 Jahre auf 6 Jahre erweitert worden. Geplant ist, diesen Betrachtungszeitraum nun auf 7 Jahre auszudehnen (§ 558 Abs. 2 BGB-Entwurf). Hintergrund: Klar ist, dass Mietspiegel auf gesammelten Mietwerten beruhen. Gesetzlich
ist vorgegeben, aus welcher Zeit diese Mietwertsammlungen stammen dürfen.
Je länger dieser Zeitraum zurückliegt, desto niedrigere Mietwerte
fließen in die Evaluierung eines Mietspiegels ein. Es kommt also
zu einer Abflachung in der Mietpreisbildung - und damit zu deutlich gedämpften
Mieterhöhungsmöglichkeiten während des Mietverhältnisses.
Erscheint also ein Mietspiegel neu, so stammen die darin verarbeiteten
Werte aktuell noch aus den letzten 6 Jahren, möglicherweise künftig
aus den letzten 7 Jahren. Anders formuliert: Wird ein Mietspiegel neu
veröffentlicht, so sind die darin enthaltenen Werte nicht aktuell,
sondern bereits älter. In der Praxis hat dies nach der starken Inflationsentwicklung
in den Jahren 2019 bis 2024 zu Überlegungen geführt, die aus
dem Mietspiegel entnommenen Mietwerte mit einem Inflationszuschlag zu
aktualisieren, um sie dann hochgerechnet und aktualisiert einem Mieterhöhungsverlangen
zugrunde zu legen. Dem hat die Rechtsprechung aus Transparenzgründen
einen Riegel vorgeschoben; als Vermieter darf man das nicht (OLG Stuttgart,
Rechtsentscheid in Mietsachen vom 02.02.1982 – 8 REMiet 4/81, NJW
1982, 945; OLG Hamburg, Rechtsentscheid in Mietsachen vom 12.11.1982 –
4 U 174/82, NJW 1983, 1803, 1805; LG München II, Urteil vom 13.10.1998
– 12 S 3258/98, WuM 1998, 726; LG München I, Hinweisbeschluss
vom 17.07.2024 - 14 S 3692/24, FD-MietR 2024, 816331; Börstinghaus,
in: Schmidt-Futterer, Kommentar zu Mietrecht, 16. Aufl. 2024, §§
558 c, 558 d BGB Rn. 72), Verpflichtung zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel in Gemeinden ab 100.000 Einwohner Die aktuell bestehende Mietspiegelpflicht für Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern wird auf die Pflicht zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels verdichtet, wenn die Gemeinde mindestens 100.000 Einwohner umfasst (§ 558 d Abs. 4 -Entwurf). Hintergrund: Die Mietspiegelreform im Jahre 2022 hat den Gemeinden die Kompetenz verliehen,
darüber zu entscheiden, ob in ihrem Gebiet ein qualifizierter Mietspiegel
gelten soll, der aufwendig und nach besonderen wissenschaftlichen Methoden
erstellt worden ist, oder ob es zum Beispiel bei einem einfachen Mietspiegel
auf der Basis erhobener, interpolierter und danach verhandelter Mietwerte
bleiben kann. Hat die Gemeinde mehr als 50.000 Einwohner, so muss sie
einen Mietspiegel selbst erstellen oder erstellen lassen und danach anerkennen
(§ 558 c Abs. 4 Satz 2 BGB). Sie kann entscheiden, ob sie den einfachen
oder den qualifizierten Mietspiegel wählt. Ausweitung der Schonfristzahlung auf die ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs. Die Wirkung einer „Schonfristzahlung“ soll über eine erklärte fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs hinaus auch auf eine hilfsweise erklärte fristgerechte Kündigung aus diesem Grund erstreckt werden (§ 573 Abs. 4 BGB-Entwurf). Hintergrund: § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB heilt die ausgesprochene fristlose Kündigung
wegen Zahlungsverzugs nachträglich, wenn die offene Forderung des
Vermieters binnen zwei Monaten seit Rechtshängigkeit der Räumungsklage
bei Gericht durch Zahlung erfüllt wird oder wenn sich eine öffentliche
Stelle (in aller Regel Sozialhilfeträger) zur Übernahme der
entstandenen Mietschulden bereit erklärt. Diese „Schonfristzahlung“
hat nach augenblicklicher Rechtslage keinerlei Auswirkungen auf eine gemeinsam
mit der fristlosen Kündigung ausgesprochene fristgerechte Kündigung
wegen Zahlungsverzugs (§ 573 Abs. 2, Nr. 1 BGB; entgegen instanzgerichtlicher
Rechtsprechung in st. Rspr. bestätigend: BGH, Urteil vom 05.10.2022
- VIII ZR 307/21, BeckRS 2022, 31738 = IMR 2023, 49; ebenso: BGH, Urteil
vom 13.10.2021 – VIII ZR 91/20, NZM 2022, 49 Rn. 29 ff; BGH, Urteil
vom 13.10.2021 - VIII ZR 91/20, IMR 2022, 13; BGH, Urteil vom 23.10.2024
– VIII ZR 106/23, BeckRS 2024, 31329). Deswegen wird kombiniert
fristlos und hilfsweise fristgerecht wegen Zahlungsverzugs gekündigt. © Dr. Hans Reinold Horst |